BerOSE - Joint Lab für Modellierung von Nanooptischen Strukturen
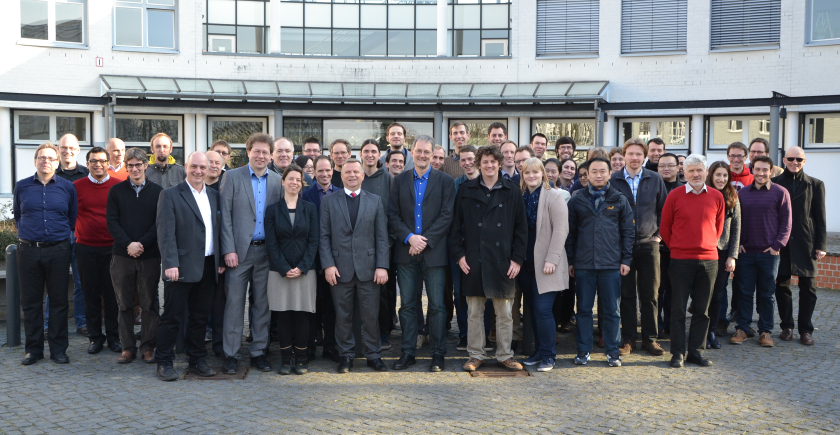
Schon auf der Eröffnungsveranstaltung war das HZB gut vertreten. Viele Arbeitsgruppen freuen sich nun auf die enge Zusammenarbeit im neuen Joint Lab mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Theorie und der Simulation. Foto: Andreas Kubatzki/HZB
HZB gründet mit FU Berlin und Zuse Institut Berlin das „Berlin Joint Lab for Optical Simulations for Energy Research (BerOSE)“
Im Joint Lab werden die speziellen Erfahrungen der Partnerinstitutionen in experimenteller und theoretischer Forschung sowie im Scientific Computing zusammengeführt. „Für die wissenschaftliche und technologische Entwicklung von komplexen nanostrukturierten Materialien für die solare Energieerzeugung und für solare Brennstoffe sind voraussagende und unterstützende dreidimensionale optische Simulationen unentbehrlich“, erklärt Prof. Dr. Christiane Becker vom HZB.
Das Joint Lab baut auf der mehrjährigen Kooperation der Partner zu Dünnschicht-Solarzellen auf. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Joint Lab konzentrieren sich nun auf Nanoplasmonik in Solarzellen, künstliche Photosynthese, nanooptische Konzepte für die Sensorik und funktionale optische Komponenten. Die geplante Forschung beinhaltet Fragestellungen aus Elektrodynamik, Moleküldynamik, Reaktionskinetik, Fluiddynamik.
Insgesamt hat das HZB mit dem Joint Lab BerOSE bereits acht gemeinsame Forschungsplattformen mit Universitäten und weiteren Partnern zu konkreten Forschungsfeldern eingerichtet. Inzwischen gelten die Joint Labs als Modell für eine langfristige Forschungszusammenarbeit zwischen außeruniversitären und universitären Forschungspartnern.
Einweihung BerOSE Joint Lab:
WANN: Am Dienstag, den 17. Februar 2015, um 10:00 Uhr
Wo: Im Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin
Takustraße 7, 14195 Berlin
Zur Homepage des BerOSE am ZIB
Mehr zu den Joint Labs des HZB erfahren sie hier:
arö
https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14140;sprache=enamp
- Link kopieren
-
Verdrehte Nanoröhren, die eine Geschichte erzählen
In Zusammenarbeit mit deutschen Wissenschaftlern haben EPFL-Forscher gezeigt, dass die spiralförmige Geometrie winziger, verdrillter Magnetröhren genutzt werden kann, um Daten zu übertragen, die nicht auf Elektronen, sondern auf Quasiteilchen, den Magnonen, basieren.
-
Gute Aussichten für Zinn-Perowskit-Solarzellen
Perowskit-Solarzellen gelten weithin als die Photovoltaik-Technologie der nächsten Generation. Allerdings sind Perowskit-Halbleiter langfristig noch nicht stabil genug für den breiten kommerziellen Einsatz. Ein Grund dafür sind wandernde Ionen, die mit der Zeit dazu führen, dass das Halbleitermaterial degradiert. Ein Team des HZB und der Universität Potsdam hat nun die Ionendichte in vier verschiedenen Perowskit-Halbleitern untersucht und dabei erhebliche Unterschiede festgestellt. Eine besonders geringe Ionendichte wiesen Zinn-Perowskit-Halbleiter auf, die mit einem alternativen Lösungsmittel hergestellt wurden – hier betrug die Ionendichte nur ein Zehntel im Vergleich zu Blei-Perowskit-Halbleitern. Damit könnten Perowskite auf Zinnbasis ein besonders großes Potenzial zur Herstellung von umweltfreundlichen und besonders stabilen Solarzellen besitzen.
-
Synchrotron-strahlungsquellen: Werkzeugkästen für Quantentechnologien
Synchrotronstrahlungsquellen erzeugen hochbrillante Lichtpulse, von Infrarot bis zu harter Röntgenstrahlung, mit denen sich tiefe Einblicke in komplexe Materialien gewinnen lassen. Ein internationales Team hat nun im Fachjournal Advanced Functional Materials einen Überblick über Synchrotronmethoden für die Weiterentwicklung von Quantentechnologien veröffentlicht: Anhand konkreter Beispiele zeigen sie, wie diese einzigartigen Werkzeuge dazu beitragen können, das Potenzial von Quantentechnologien wie z. B. Quantencomputing zu erschließen, Produktionsbarrieren zu überwinden und den Weg für zukünftige Durchbrüche zu ebnen.
