Traditionsreiche HZB-Neutronenschule wird an ANSTO in Australien weitergeführt
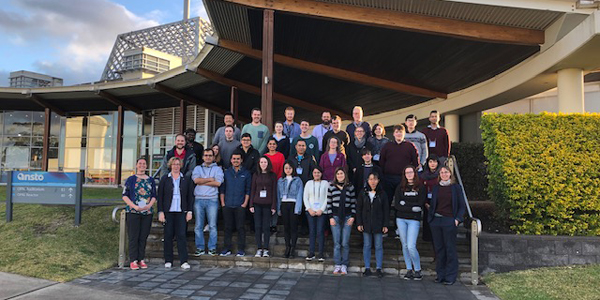
Die Neutronenschule am ANSTO in Kooperation mit HZB-Expertinnen konnte den Teilnehmenden viel Wissen vermitteln. © ANSTO
Diesen Sommer haben Forscherinnen und Forscher an der australischen Neutronenquelle ACNS bei Australia’s Nuclear Science and Technology Organisation ANSTO eine gemeinsame Neutronenschule organisiert. Die HZB-ANSTO Neutronenschule soll künftig alle zwei Jahre stattfinden.
Die erste gemeinsame HZB-ANSTO Neutronenschule fand vom 23. - 28. Juni 2019 am ANSTO statt. Aus dem HZB hatten Prof. Dr. Bella Lake und Prof. Dr. Susan Schorr mehrere Vorlesungen übernommen. Das Interesse an der Neutronenschule war sehr groß, aus 60 Bewerbungen wurden 24 Teilnehmende ausgesucht. Neben Vorlesungen gab es insbesondere auch praktische Trainings an drei Instrumenten der Neutronenquelle ACNS bei ANSTO.
„Wir haben uns bei der Konzeption von der umfassenden Ausbildung der Neutronenschule in Berlin, am HZB, inspirieren lassen“, sagte Dr. Helen Maynard-Casely, eine der Organisatorinnen bei ANSTO. Künftig werde ein zweijähriger Rhythmus angedacht, möglicherweise auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten, zum Beispiel für Ingenieure.
Kurz vor Beginn der Neutronenschule konnte das Instrument SPATZ an der ACNS den Betrieb aufnehmen. SPATZ stammt ursprünglich aus der Berliner Neutronenquelle BER II und trug am HZB den Namen BioRef. Das Instrument ermöglicht einzigartige Einblicke in Energiematerialien, weiche Materie und biomedizinische Fragestellungen. Es wurde nach Australien transferiert, um auch nach Abschaltung des BER II der Forschung zur Verfügung zu stehen.
In einem kurzen Video berichtet ANSTO über den Transfer und den Aufbau von SPATZ.
arö
https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=20628;sprache=de
- Link kopieren
-
Was die Zinkkonzentration in Zähnen verrät
Zähne sind Verbundstrukturen aus Mineralien und Proteinen, dabei besteht der Großteil des Zahns aus Dentin, einem knochenartigen, hochporösen Material. Diese Struktur macht Zähne sowohl stark als auch empfindlich. Neben Kalzium und Phosphat enthalten Zähne auch Spurenelemente wie Zink. Mit komplementären mikroskopischen Verfahren hat ein Team der Charité Berlin, der TU Berlin und des HZB die Verteilung von natürlichem Zink im Zahn ermittelt. Das Ergebnis: mit zunehmender Porosität des Dentins in Richtung Pulpa steigt die Zinkkonzentration um das 5- bis 10-fache. Diese Erkenntnis hilft, den Einfluss von zinkhaltigen Füllungen auf die Zahngesundheit besser zu verstehen und könnte Verbesserungen in der Zahnmedizin anstoßen.
-
Topologische Überraschungen beim Element Kobalt
Das Element Kobalt gilt als typischer Ferromagnet ohne weitere Geheimnisse. Ein internationales Team unter der Leitung von Dr. Jaime Sánchez-Barriga (HZB) hat nun jedoch komplexe topologische Merkmale in der elektronischen Struktur von Kobalt entdeckt. Spin-aufgelöste Messungen der Bandstruktur (Spin-ARPES) an BESSY II zeigten verschränkte Energiebänder, die sich selbst bei Raumtemperatur entlang ausgedehnter Pfade in bestimmten kristallographischen Richtungen kreuzen. Dadurch kann Kobalt als hochgradig abstimmbare und unerwartet reichhaltige topologische Plattform verstanden werden. Dies eröffnet Perspektiven, um magnetische topologische Zustände in Kobalt für künftige Informationstechnologien zu nutzen.
-
KI analysiert Dinosaurier-Fußabdrücke neu
Seit Jahrzehnten rätseln Paläontolog*innen über geheimnisvolle dreizehige Dinosaurier-Fußabdrücke. Stammen sie von wilden Fleischfressern, sanften Pflanzenfressern oder sogar frühen Vögeln? Nun hat ein internationales Team künstliche Intelligenz eingesetzt, um dieses Problem anzugehen – und eine kostenlose App entwickelt, die es jeder und jedem ermöglicht, die Vergangenheit zu entschlüsseln.
