Gemeinsame Plattform für die Makromolekulare Kristallographie an europäischen Synchrotronen
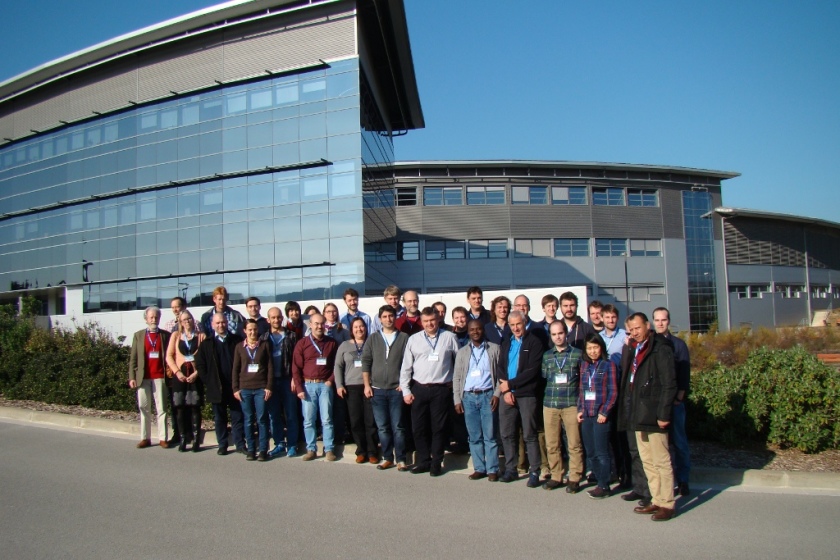
Regelmäßig gibt es einen Austausch der verantwortlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschafter aus verschiedenen Synchrotronen, um mit MXcuBE ein nutzerfreundliches System zu entwickeln.
Hier: Treffen vom 1. bis 2. Dezember 2015 an Alba, Spanien. Foto: Jordi Juanhuix/ALBA
Um Biostrukturen und damit die Baupläne des Lebens zu entschlüsseln, nutzen Forscher das hochintensive Röntgenlicht von Synchrotronstrahlungsquellen. Seit 2012 gibt es eine Kooperationsvereinbarung, um an mehreren europäischen Quellen gemeinsame Software-Standards zu etablieren. Das Ziel: Die acht beteiligten Synchrotrone wollen an den 30 Experimentierplätzen für die Makromolekulare Kristallographie nutzerfreundliche, standardisierte Bedingungen schaffen, die das Arbeiten für die Forschergruppen erleichtern. Im neuen Projekt „MXCuBE3“ wird die vorhandene Software-Plattform an neuste technologische Entwicklungen angepasst.
In den letzten Jahren wurden viele Beamlines für die Makromolekulare Kristallographie an den Synchrotronen aufwendig modernisiert. Unter anderem kamen neue Experimentiermöglichkeiten und neuste hochauflösende Detektoren hinzu. Nun muss die gemeinsame Software-Plattform MXCuBE2 angepasst werden, um mit dieser Entwicklung Schritt halten zu können. Das Kuratorium hat sich dafür ausgesprochen, eine neue, generalüberholte Version zu entwickeln. Mithilfe der Softwarelösung MXCuBE3 sollen sich Experimente über eine Webapplikationen steuern lassen. Das Upgrade sichert außerdem, dass MXCuBE3 auch bei zukünftigen Betriebssystemen auf den Computern läuft, und verbessert die Anbindung an die Experiment-Datenbank ISPyB.
An der Kooperation beteiligt sind das Helmholtz-Zentrum Berlin, die ESRF, das European Molecular Biology Laboratory, Global Phasing Limited, MAX-VI-Lab in Schweden, SOLEIL in Frankreich, ALBA in Spanien und das DESY.
Einen ausführlichen Bericht finden Sie im Magazin der ESRF.
(sz)
https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14380;sprache=de/
- Link kopieren
-
Verdrehte Nanoröhren, die eine Geschichte erzählen
In Zusammenarbeit mit deutschen Wissenschaftlern haben EPFL-Forscher gezeigt, dass die spiralförmige Geometrie winziger, verdrillter Magnetröhren genutzt werden kann, um Daten zu übertragen, die nicht auf Elektronen, sondern auf Quasiteilchen, den Magnonen, basieren.
-
Ernst-Eckhard-Koch-Preis und Innovationspreis Synchrotronstrahlung 2025
Der Freundeskreis des HZB zeichnete auf dem 27. Nutzertreffen BESSY@HZB die Dissertation von Dr. Enggar Pramanto Wibowo (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) aus.
Darüber hinaus wurde der Europäische Innovationspreis Synchrotronstrahlung 2025 an Prof. Tim Salditt (Georg-August-Universität Göttingen) sowie an die Professoren Danny D. Jonigk und Maximilian Ackermann (beide, Universitätsklinikum der RWTH Aachen) verliehen.
-
Gute Aussichten für Zinn-Perowskit-Solarzellen
Perowskit-Solarzellen gelten weithin als die Photovoltaik-Technologie der nächsten Generation. Allerdings sind Perowskit-Halbleiter langfristig noch nicht stabil genug für den breiten kommerziellen Einsatz. Ein Grund dafür sind wandernde Ionen, die mit der Zeit dazu führen, dass das Halbleitermaterial degradiert. Ein Team des HZB und der Universität Potsdam hat nun die Ionendichte in vier verschiedenen Perowskit-Halbleitern untersucht und dabei erhebliche Unterschiede festgestellt. Eine besonders geringe Ionendichte wiesen Zinn-Perowskit-Halbleiter auf, die mit einem alternativen Lösungsmittel hergestellt wurden – hier betrug die Ionendichte nur ein Zehntel im Vergleich zu Blei-Perowskit-Halbleitern. Damit könnten Perowskite auf Zinnbasis ein besonders großes Potenzial zur Herstellung von umweltfreundlichen und besonders stabilen Solarzellen besitzen.
